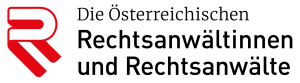Sie sind Rechtsanwältin und Partner in einer Familienkanzlei in Wien, die schon von ihren Eltern gegründet wurde. War dieser Weg für sie schon immer klar oder was hat sie für den Beruf der Rechtsanwältin begeistert?
Schon als Volksschulkind wollte ich dasselbe machen wie meine Mami, nämlich viel telefonieren, handschriftliche Konzepte aufkritzeln und mit der Rechenmaschine Konkursquoten und Verteilungsentwürfe auf den Groschen genau berechnen; darin bestand für mich das Dasein als Rechtsanwältin. Dieses Vorhaben, also zumindest das Jusstudium, hinterfragte ich erstmals in der siebenten oder achten Klasse Gymnasium, als Berufs- und Studienberater in die Schule kamen und sich meine Freundinnen den Kopf darüber zerbrachen, was sie denn nach der Matura anfangen wollten. Ich hatte eigentlich nicht einmal eine ungefähre Idee davon, was das Jusstudium bieten oder bedeuten würde und rechnete mit einem durchaus trockenen Auswendiglernen von Paragraphen. Wie so häufig nutzte ich die Erfahrung meiner älteren Schwester, der ich in vielen Dingen ähnlich bin. Sie hatte diverse Tests durchlaufen, um die Studienrichtung herauszufinden, für welche sie begabt wäre. Das Ergebnis ergab eindeutig, dass sie entweder Sprachen oder Jus studieren sollte. Damit hatte ich quasi meine amtliche Bestätigung, dass Jus auch für mich das Passende wäre. Im Studium war ich dann sehr erleichtert, festzustellen, dass es mir großen Spaß machte und alles andere als trocken war! In einer auf Logik basierenden Geisteswissenschaft fühlte und fühle ich mich wirklich gut eingesetzt. Die Entscheidung für die Selbständigkeit war natürlich schon massiv davon beeinflusst, dass ich in die elterliche Rechtsanwaltskanzlei einsteigen konnte. Ohne diesen Background hätte ich mich vielleicht nicht drüber getraut. Sehr bald war ich dann aber unendlich froh, meine eigene Herrin zu sein.
Oft hört man, dass familiäre Beziehungen sowie Freundschaften aufgrund Differenzen bei der Zusammenarbeit zerbrechen. Welche Tipps haben sie für AnwältInnen, die eine Kanzlei mit Verwandten oder Freunden gründen möchten?
Bei einer gemeinsamen Kanzleigründung muss einem klar sein, dass die zuvor in aller Regel bereits vorhandene freundschaftliche Beziehung um einen wesentlichen Aspekt erweitert wird, weil es für alle Beteiligten um den Aufbau und den Erhalt der eigenen wirtschaftlichen Existenz geht. An eine solche Partnerschaft müssen daher andere Anforderungen gestellt werden als an eine noch so gute Freundschaft. Es muss einem klar sein, dass eine solche Partnerschaft großen Belastungen ausgesetzt sein wird. Daher muss man sich ex ante ganz kritisch die Frage stellen, ob die eigene Persönlichkeit mit jener des in Aussicht genommenen Kanzleipartners derartigen Belastungen gewachsen sein wird. Unumgänglich ist, dass zwischen den Kanzleipartnern ein gefestigtes Vertrauensverhältnis besteht, und aus meiner Sicht sollte auch der Zugang zu den wesentlichen Fragen – welche Klienten möchte man ansprechen? Wie ernsthaft betreibt man den Beruf? Welche Vorstellung hat man von der Kanzleiorganisation? – übereinstimmen.
Wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung muss man auch hier ständig an sich und der Partnerschaft arbeiten und wechselseitig ein offenes Ohr haben. Die Erfahrung lehrt, dass das Zerbrechen von Rechtsanwaltskanzleipartnerschaften oft mit demselben Ingrimm betrieben wird wie Scheidungen. Die Beziehung sollte daher gleichermaßen aufmerksam gepflegt werden.
Welche drei Punkte sollte man Ihrer Meinung nach unbedingt regeln bzw klären, bevor man eine Kanzlei mit Verwandten oder Freunden gründet?
Wie zuvor ausgeführt denke ich, die wesentlichen Entscheidungen sind die Ausrichtung der Kanzlei inhaltlich; der finanzielle Aspekt in jeglicher Hinsicht; und schließlich der ungefähre Weg, wie man diese Ziele erreichen möchte.
Sie sind fachlich breit aufgestellt – ihre Beratungsschwerpunkte reichen vom Insolvenzrecht, Konsumentenschutzrecht, Wettbewerbsrecht bis hin zum Erwachsenenschutzrecht. Was sagen Sie zu dem vermeintlich Trend in Richtung ‚Spezialisierung‘ auf ein (einziges) Fachgebiet als AnwältIn?
Mir wäre eine Spezialisierung auf ein einziges Fachgebiet zum einen viel zu eintönig, selbst wenn es so ein breites Fachgebiet ist wie das Insolvenzrecht. Zum anderen setze ich nie gerne alles auf eine Karte. Geschäftsbereiche können aus faktischen, noch schneller aber aus rechtlichen Gründen mit dem Federstrich des Gesetzgebers wegfallen. Mir wäre eine enge fachliche Eingrenzung daher wirtschaftlich schlicht zu riskant.
Welchen Tipp haben Sie für junge Juristinnen, die sich nicht sicher sind, auf welches Rechtsgebiet sie sich spezialisieren sollen?
Nutzen Sie das Gerichtsjahr und Ihre Praxiszeiten, um sich möglichst viele Fachgebiete und deren Arbeitsmöglichkeiten in der Praxis anzusehen. Sie werden sicher schnell herausfinden, was Ihnen mehr liegt, und was weniger!
Sie sind Dr.in der Rechtswissenschaften. Ist das Doktorat der Rechtswissenschaften etwas, das sie jungen AnwältInnen für Ihre berufliche Praxis empfehlen würden?
Für mich gehörte das Doktorat ein wenig zu dem Plan, alles genauso zu machen wie meine Mutter, mein Vorbild seit jeher. Außerdem gehöre ich noch zu einer Generation, in welcher zumindest die Klienten den Titel schätzen. Mir persönlich hat es auch viel Freude gemacht, mich neben der sehr praxisbezogenen Arbeitsweise als Konzipientin auch wieder auf die „reine Lehre“ einlassen zu können.
Viele AbsolventInnen entscheiden sich aufgrund des verschrienen Rufs der Anwaltei gegen den Beruf der RechtsanwältIn. Bis zu welchem Maß ist dieser Ruf Ihrer Meinung nach berechtigt?
Wenn man meint, der Ruf der Anwaltei sehr schlecht, weil die Anwälte Halsabschneider wären (also das amerikanische Berufsbild zu uns herübergeschwappt ist), so kann ich nur alle Kolleginnen aufrufen, diesem Bild durch anständige und seriöse Berufsausübung entgegenzutreten. Hält man das Berufsbild für mit Familienleben unvereinbar, so muss ich schon zugeben, dass der Beruf sicherlich sehr zeitaufwändig ist. Dafür hat man den Vorteil, sich vieles einteilen zu können. Gerade Kolleginnen, die Kinder groß ziehen oder großgezogen haben, waren über die ganz flexiblen Möglichkeiten der Arbeitseinteilung sehr froh.
Was man aber in Kauf zu nehmen bereit sein muss, ist die Tatsache der Selbständigkeit und damit des nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Risikos.
In wieweit besteht Ihrer Erfahrung nach die Möglichkeit, sich im Rahmen der eigenen Kanzlei die Arbeitsbedingungen nach eigenen Belieben und Abseits der Norm zu gestalten (kürzere Arbeitszeiten, flexibler Arbeitsort, etc)?
Ich denke, dass die Flexibilität hier extrem gestiegen ist und weiter steigt. Durch die Möglichkeiten, über das Internet tatsächlich von jedem Winkel der Erde aus auf das eigene Kanzleiprogramm zugreifen zu können, ist unser Arbeitsort ubiquitär geworden.
Von Verhandlungen und Besprechungen abgesehen sind die Arbeitszeiten völlig frei einteilbar. Erwartungsgemäß hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der elektronischen Teilnahme an Verhandlungen über Corona hinaus beibehalten, sodass selbst für Kollegen, die viel verhandeln, der Arbeitsort zunehmend flexibel ist.
Auf was achten Sie besonders bei der Ausbildung der RechtsanwaltsanwärterInnen in Ihrer Kanzlei?
Dass sie in allen Rechtsgebieten, die unsere Kanzlei bearbeitet – und das sind in Folge unserer Tätigkeit als Masseverwalter nahezu alle Rechtsgebiete mit Ausnahme des Familien- und weiten Teilen des Strafrechts – zum Einsatz kommen; dass sie selbständiges Arbeiten lernen, allerdings unter sehr ernstgenommener Aufsicht der Ausbildungsrechtsanwälte; dass sie seriösen Umgang den Klienten, den Richtern und den Kollegen gegenüber ebenso wie dem Beruf als solchen verinnerlichen.
Welchen Tipp haben Sie für junge Juristinnen, die den Beruf der RechtsanwältIn ausüben möchten, ihr Privat- und Familienleben aber nicht hinten anstellen möchten?
Job ist Job und Schnaps ist Schnaps – wenn Sie arbeiten, arbeiten Sie konzentriert und wenn Sie Freizeit haben, haben Sie ausschließlich Freizeit. Ich selbst habe den Fehler gemacht, in den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit als Rechtsanwältin Akten mit nach Hause zu nehmen, und diese nach dem gemeinsamen Abendessen zu bearbeiten. Das hat zu allseitigen Frustrationen geführt und meine Arbeitsergebnisse nicht verbessert. Umgekehrt empfinde ich es als durchaus anstrengend, im Kanzleialltag auch noch private Themen bedenken oder behandeln zu müssen. Ich habe daher auch nur ein privates Handy. Meine Klienten erreichen mich über E-Mail oder über das Festnetztelefon. Freunde und Familie erreichen mich über das private Handy, das ich in der Kanzleizeit auch häufig ausschalte. Dafür gibt es, von Ausnahmesituationen wie z.B. in aufwendigen Fortführungen von Unternehmen im Sanierungsverfahren oder bei dramatischen Entwicklungen in Erwachsenenvertretungen abgesehen, am späteren Abend und am Wochenende sowie im Urlaub für mich schlicht keine Kanzlei.